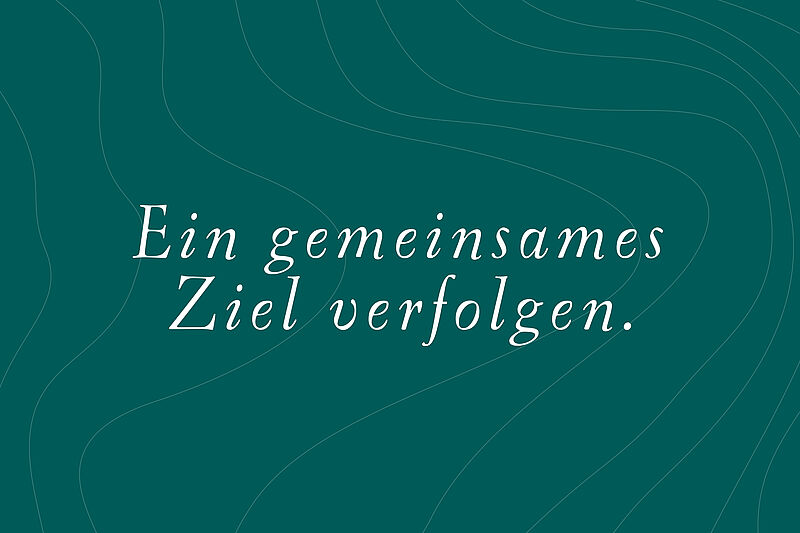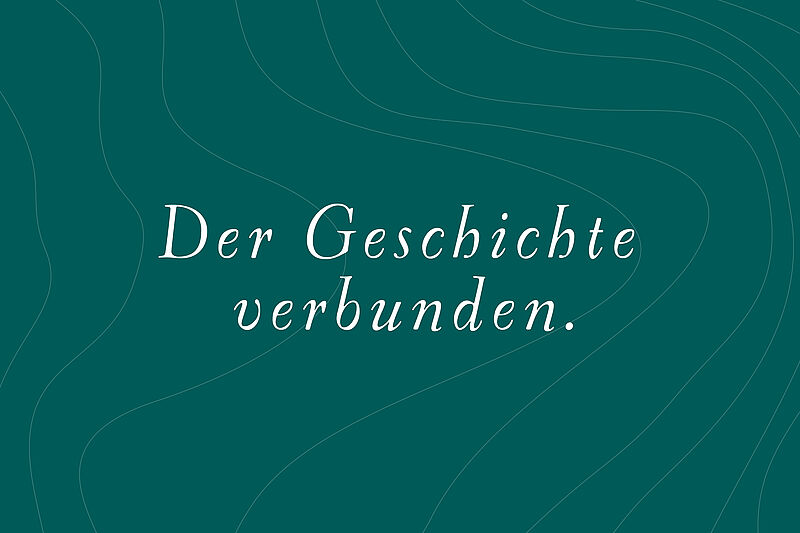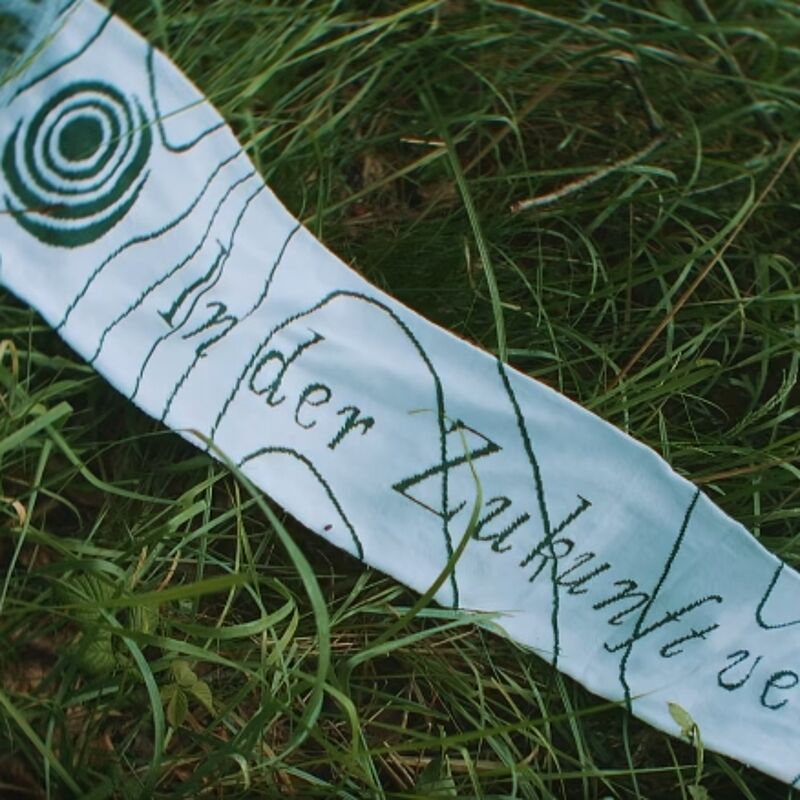In der Zukunft verwurzelt.
Im Jahr 2025 feierten die Bundesforste ein ganz besonderes Jubiläum: 100 Jahre. Das gesamte Jahr war von diesem bedeutenden Meilenstein geprägt. Zahlreiche spannende Aktivitäten, Einblicke und Aktionen begleiteten ihn – darüber haben wir hier laufend berichtet und stellen die Inhalte auch weiterhin zum Nachlesen zur Verfügung.
Im Kalender 2025 schickten wir einen Baum auf Zeitreise durch die vergangenen 100 Jahre. In kunstvoll gestalteten Bildern wurde der Baum im Stil jeder Dekade präsentiert – ein kreativer Blick auf die Verbindung zwischen Natur, Kunst und Geschichte. Einen kleinen Einblick gibt es auch noch hier in unserem Video zum damaligen Jahreswechsel.
Und wer auch weiterhin mit unserem Newsletter informiert werden möchte, hat hier gerne Gelegenheit sich anzumelden: